The AREA (Alliance for Research on East Asia) Ruhr Working Papers offer insights into ongoing and completed research projects on East Asia – from a variety of disciplinary approaches. Please feel free to download any issue via our website.
We would like to thank the Specialized Information Service Asia / CrossAsia for their cooperation in publishing the papers.
Alliance for Research on East Asia (AREA) Ruhr Working Papers
DOI: 10.48796/20240617-000
ISSN: 2510-9928

Volume 1 (2024)
China’s Innovation Drive: A Review of the Systems of Innovation Literature
Hofmann, Karolin / Gottwald, Jörn-Carsten / Taube, Markus / Hofmann, Anja
Kurzfassung (German)
Vor dem Hintergrund der innovationspolitischen Bestrebungen Chinas untersucht dieser Artikel, inwieweit die bestehende Literatur zu Innovationssystemen die aktuelle Innovationsdynamik des Landes zu erfassen vermag und welche Desiderate sich für die zukünftige Forschung ergeben.
Die 2016 von der chinesischen Führung verkündete „National Innovation-Driven Development Strategy“ formuliert das Ziel, China bis 2050 als globale Innovationssupermacht zu etablieren, indem die inländische Innovationskraft gestärkt und Technologieimporte reduziert werden. Für ausländische Unternehmen, die in China tätig sind, bedeutet dies, dass sich die ohnehin schon ungleichen Wettbewerbsbedingungen auf dem chinesischen Markt nun noch stärker zugunsten heimischer Unternehmen verschieben werden. Gleichzeitig führt die von Xi Jinping forcierte Rezentralisierung der Staatsmacht dazu, dass der Handlungsspielraum der Lokalregierungen, die wesentlich zum wirtschaftlichen Aufstieg Chinas beigetragen haben, zunehmend eingeschränkt wird. Diese Entwicklung wirft die Frage auf, ob Xis hierarchisch-protektionistischer Regierungsstil die innovationspolitischen Vorhaben Pekings nicht eher behindert als fördert.
Im Vergleich zum Konzept der Innovationsökosysteme, das sich im Wesentlichen auf den Bereich der Unternehmensstrategie beschränkt, betrachtet das Innovationssystem-Konzept Innovation als ein kontextübergreifendes Phänomen. Letzteres betont zudem die synergistische Beziehung zwischen Wissensströmen und Innovationsfähigkeit stärker und lässt sich in verschiedene Subsysteme gliedern. Im vorliegenden Artikel wird der Fokus auf nationale (NIS), regionale (RIS), sektorale (SIS) und technologische (TIS) Innovationssysteme gelegt.
Da die Grenzen der einzelnen Innovationssysteme und deren Variablen nicht einheitlich definiert sind, ist es fraglich, wie sinnvoll die Unterteilung in verschiedene Subsysteme ist. Gleichzeitig ermöglicht die Fluidität des Konzepts eine Übertragung auf unterschiedliche Länderkontexte. Um die Aussagekraft des Innovationssystem-Konzepts als Analyseinstrument zu verbessern, können komplementäre theoretische Rahmen wie das Triple Helix-Modell (Etzkowitz und Leydesdorff, 1995; 2000) oder das Konzept der „national innovative capacity“ (Furman et al., 2002) integriert werden.
Die ersten englischsprachigen Publikationen zu China erschienen in den späten 1990er Jahren und basieren überwiegend auf dem NIS-Ansatz. In den meisten Werken wird die Reform- und Öffnungspolitik als entscheidender Wendepunkt in der Innovationsentwicklung des Landes betrachtet, da diese zu einer Verlagerung des Innovationsfokus vom Verteidigungssektor auf den zivilen Sektor sowie zu einem Aufbrechen der traditionellen Arbeitsteilung zwischen öffentlichen Forschungsinstituten, Universitäten und Staatsunternehmen geführt hat. Chinesischsprachige Publikationen aus dieser Zeit konzentrieren sich ebenfalls primär auf die nationale Ebene, beschäftigen sich aber weniger mit der Anwendung des Innovationssystem-Konzepts als mit der Frage, wie ein NIS in China überhaupt realisierbar ist.
Seit dem Amtsantritt von Xi Jinping ist die Zahl der chinesischsprachigen Publikationen, die sich mit dem Innovationssystem Chinas befassen, deutlich höher als die der englischsprachigen. In beiden Sprachen ist die Literatur jedoch vielfältiger und spezialisierter geworden. Zwei Arten von Innovationssystemen, die in chinesischen Werken häufig thematisiert werden, sind „military-civil fusion innovation systems“ und „agricultural innovation systems“. Für die weitere Forschung sollten neben dem Triple Helix-Modell und dem Konzept der „national innovative capacity“ auch politische Trends (z.B. politische Rezentralisierung) und Schlagworte (z.B. „new-style whole-of-nation“) sowie das Verhältnis Chinas zum Rest der Welt, insbesondere zu „westlichen“ Ländern, in die Analyse einbezogen werden. Letzteres ist insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden globalen Versicherheitlichung von Technologien, Wissenschaft und Innovation relevant.

Volume 2 (2024)
Party-State Dominated Economic Governance: The Politics of Regulation in China’s Steel- and Fintech-Sectors
Gottwald, Jörn-Carsten / Taube, Markus
Kurzfassung (German)
Am Beispiel der Stahlindustrie und des FinTech-Sektors analysiert der Artikel die parteistaatliche Regulierung und zunehmende Ideologisierung der chinesischen Wirtschaft unter Präsident Xi Jin-ping. Den theoretischen Rahmen bilden das Konzept der „Marketcraft“ (Vogel, 2018), welches zu erklären versucht, wie der Staat (d.h. die Regierung) Märkte stärkt, kontrolliert und manipuliert, sowie das Konzept der „Regulatory Governance“.
Die Beziehungen zwischen Staat und Wirtschaft in der Stahlindustrie lassen sich in zwei Phasen unterteilen. In der ersten Phase, die sich von den ersten Reformjahren in den 1980er Jahren bis zum Amtsantritt von Xi Jinping erstreckte, war die chinesische Wirtschaft stark fragmentiert und bestand aus regionalen Industrien, die kaum miteinander interagierten. Diese Struktur spiegelte sich auch in der Stahlindustrie wider, wo sich eine Art „vertikales Kartell“ aus staatlichen und wirtschaftlichen Akteuren als zentrale Regulierungs- bzw. Entscheidungsinstanz herausgebildet hatte. Auf nationaler Ebene führte diese Konstellation zu einer umfassenden technologischen Modernisierung und zu massiven Kapazitätserweiterungen einer Reihe von Stahlwerken, deren Entwicklung jedoch durch leistungsschwache Stahlwerke in von lokalen Interessen geschützten Nischenmärkten massiv behindert wurde.
Unter Xi wurde das „vertikale Kartell“ als wichtigste Entscheidungsinstanz der Stahlindustrie in ein vielseitig ausgerichtetes Konsortium umfunktioniert, das mit der Erhebung und Verarbeitung von Daten beauftragt ist, um die Politikgestaltung der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) zu unterstützen. Um die Durchsetzung zentralstaatlicher Interessen langfristig zu sichern, infiltriert die KPCh zum einen systematisch die Führungsebene von Unternehmen und greift so direkt in interne Entscheidungsfindungsprozesse ein; zum anderen agiert sie durch Akteure wie die China Iron and Steel Association (CISA) oder State-owned Capital Investment Enterprises (SOCIE), die steuernd in bestimmte Marktprozesse eingreifen.
Anders als die Stahlindustrie wurde der chinesische FinTech-Sektor erst im Zuge seines enormen Einflussgewinns staatlicher Regulierung unterworfen. Nach etlichen Betrugsfällen und Protesten sowie dem gescheiterten Versuch, FinTech-Start-ups und etablierte Banken in den bestehenden Regulierungsrahmen zu integrieren, wurden 2015 in den „Guiding Opinions“ erstmals sowohl die Grundsätze für die Regulierung der Internetfinanzierung als auch die Regulierungskompetenzen auf nationaler Ebene festgelegt. Federführend war dabei die People’s Bank of China (PBOC), die direkt dem Staatsrat untersteht.
Seit dem Amtsantritt von Präsident Xi hat die staatliche Regulierung des FinTech-Sektors weiter zugenommen und sogar zur vollständigen Abschaffung des Peer-to-Peer (P2P)-Marktsegments geführt. Höhepunkt dieser Entwicklung war die erzwungene Umstrukturierung von Ant Financial, dem Internet-Finanzierungszweig von Alibaba, nachdem dessen Gründer Jack Ma öffentlich Kritik an Chinas Regulierungspolitik geübt hatte. Die Reaktion der chinesischen Regierung zeigt, dass Unternehmen wie Ant Financial nicht nur zu einer Gefahr für die makroökonomische Stabilität und die Integrität des chinesischen Wirtschaftssystems insgesamt geworden sind, sondern auch ein politisch-ideologisches Risiko darstellen, wenn sie von der Parteilinie abweichen. Der FinTech-Sektor wurde 2023 unter das regulatorische Dach des chinesischen Finanzsystems gebracht. Es gibt jedoch keine Behörde, die direkt für FinTech zuständig ist.

Volume 3 (2025)
AI-Development in Tianjin, PR China: Triple Helix Patterns for a “Mission-oriented” Innovation Endeavor
Taube, Markus
Kurzfassung (German)
Der Artikel konzeptualisiert Chinas innovationsbezogene Ambitionen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) als „grand project“, das den Prinzipien einer „missionsorientierten“ Innovationspolitik folgt. Auf der Grundlage des Triple Helix-Modells werden aktuelle KI-Entwicklungen am Beispiel der Stadt Tianjin analysiert.
Das Triple Helix-Modell (Etzkowitz & Leydesdorff, 1995; 1996) sieht Innovation als einen Prozess, der durch Interaktionen zwischen Wissenschaft (academia), Wirtschaft (industry) und Regierung (government) bestimmt wird. Es gibt drei generische Ausprägungen des Triple Helix-Modells: das „statist“-Modell, das durch eine starke Regierung gekennzeichnet ist, die Wissenschaft und Wirtschaft kontrolliert und Ziele für die technologische Entwicklung vorgibt; das „laissez-faire“-Modell, das durch ein hohes Maß an Unabhängigkeit der Stränge voneinander definiert ist; und das „balanced“-Modell, in dem alle Stränge so eng miteinander verflochten sind, dass sie beginnen, “die Rolle des jeweils anderen zu übernehmen” (Etzkowitz & Zhou, 2017a, S. 40), was zur Entstehung hybrider Institutionen führt.
Das Triple Helix-Modell ist in erster Linie ein wissenschaftliches Modell, das der Beschreibung, Kategorisierung und Analyse von Innovationsregimen dient und – im Gegensatz zur missionsorientierten Innovationspolitik – keinen normativen Anspruch hat. Missionsorientierte Innovationspolitik (Mazzucato, 2018; Wanzenböck et al., 2020) fokussiert auf die Verwirklichung konkreter Ziele und vertraut nicht darauf, dass Märkte die gesetzten Ziele erreichen. Daraus ergibt sich die Forderung nach einer starken, aber nicht top-down ausgerichteten Führungsrolle der Regierung. Die missionsorientierte Innovationspolitik ist damit am ehesten mit dem “balanced” Triple Helix-Modell vereinbar.
Es gibt nur wenige Studien, die versuchen, ein umfassendes Triple Helix-Modell zu erstellen, das die Strukturen des nationalen Innovationssystems Chinas als Ganzes abbilden kann. Ein Großteil der Literatur betont die dominante Rolle der Zentralregierung als Lenkungs- und Kontrollinstanz. Gleichzeitig zeigen einige Studien, dass lokale Regierungen je nach Region und Technologiefeld über erhebliche Handlungsspielräume verfügen. Die Handlungsspielräume zentraler und lokaler Regierungsorganisationen sind jedoch nicht festgelegt und können im Laufe der Zeit neu definiert und abgegrenzt oder von einem Akteur auf einen anderen übertragen werden.
Aufgrund seines polymorphen Charakters erscheint das chinesische Innovationssystem für die Einführung missionsorientierter innovationspolitischer Ziele – insbesondere im Bereich KI – mehr als geeignet. Dies setzt allerdings folgende Handlungskompetenzen der Akteure voraus:
- Regierung:
- Zentralregierung: Festlegung von Zielen, Entscheidung über beteiligte Akteure, Zuweisung von Ressourcen, Festlegung von Handlungsspielräumen, Überprüfung der Zielerreichung anhand von Leistungsindikatoren, Anpassung von Zielen und Meilensteinen an den tatsächlichen Fortschritt.
- Lokalregierungen: Erfüllungsgehilfen zentraler Vorgaben, autonome Umsetzung von missionsorientierten innovationspolitischen Zielen in Bereichen mit höherer Informations- und Umsetzungskapazität als auf Ebene zentralstaatlicher Behörden; Anleitung von Wissenschaft und Wirtschaft, Katalysator für grenzüberschreitende Initiativen von Wirtschaft und Wissenschaft.
- Wirtschaft: Anpassen der Unternehmenstätigkeit an nationale „Mission“, Kooperation mit wissenschaftlichen Einrichtungen.
- Wissenschaft: Ausrichtung der Aktivitäten und Ressourcen auf Missionsziele, Partnerschaften mit (inter-)nationalen Akteuren aus der Wissenschaft und Technologie sowie innovationsorientierten Unternehmen, politikorientierten Think Tanks und Normungsorganisationen.
Die in Tianjin beobachtete Triple Helix-Konstellation erfüllt die Anforderungen an eine Interaktion zwischen Regierung, Wissenschaft und Wirtschaft, die mit einer „missionsorientierten“ Politik kompatibel ist. Es wird ein „balanced“ Triple-Helix-System mit einer im Vergleich zur lokalen Regierung asymmetrisch starken Zentralregierung identifiziert, in dem die Kooperation zwischen den Helix-Strängen durch ausgeprägte grenzüberschreitende Aktivitätsmuster charakterisiert zu sein scheint, die einen intensiven Austausch zwischen verschiedenen Akteuren ermöglichen. Vor diesem Hintergrund haben sich drei hybride Institutionen herausgebildet: das “Chinese Institute of New Generation Artificial Intelligence Development Strategies” (CINGAI), das an der Schnittstelle zwischen Regierung und Wissenschaft angesiedelt ist und die Funktion der „Strategieentwicklung“ übernimmt; das Tianjin City Artificial Intelligence Computing Center (TAICC), das Wissenschaft und Wirtschaft (unter Leitung der Regierung) miteinander verbindet und für die „Strategieumsetzung“ verantwortlich ist; und der „World Intelligence Congress“, der als Marktplatz dient, auf dem Informationen zwischen allen drei Strängen der Helix ausgetauscht werden und neue Kooperationsmöglichkeiten für die Weiterentwicklung von KI entstehen.
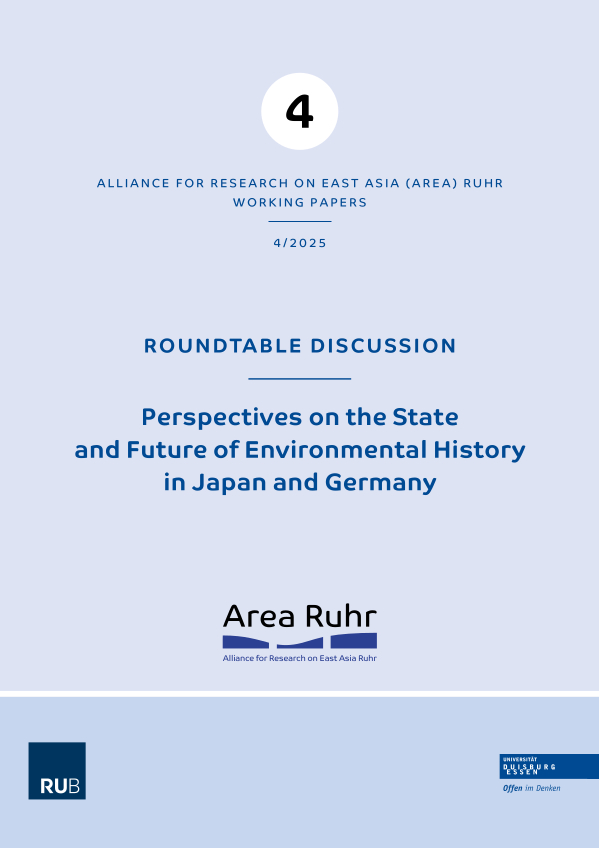
Volume 4 (2025)
Perspectives on the State and Future of Environmental History in Japan and Germany: Roundtable Discussion
Asmussen, Tina / Fujihara, Tatsushi / Uekötter, Frank / Watanabe, Kōichi
Jacoby, Julia Mariko (ed.) / Schmidtpott, Katja (ed.)
Kurzfassung (German)
Bei diesem Dokument handelt es sich um ein bearbeitetes Transkript einer Roundtable-Diskussion zum Stand und der Zukunft der Umweltgeschichte in Japan und Deutschland, die Ende September 2024 am Deutschen Bergbaumuseum Bochum mit der Unterstützung von Alliance for Research on East Asia (AREA) Ruhr und dem Leibniz-WissenschaftsCampus „Resources in Transformation“ (ReForm) stattfand. Teilgenommen haben aus Japan Watanabe Kōichi (Katastrophen- und Stadtgeschichte, Frühe Neuzeit) und Fujihara Tatsushi (Ernährungsgeschichte, Neuzeit), aus Deutschland Tina Asmussen (Bergbaugeschichte der Frühen Neuzeit) und Frank Uekötter (Technik- und Umweltgeschichte), die unter der Gesprächsleitung von Julia Mariko Jacoby und Katja Schmidtpott über bisherige und aktuelle Forschungsthemen, Herausforderungen und Zukunftsperspektiven der Umweltgeschichte in beiden Ländern diskutierten. Die Diskussion umfasste folgende Themen:
- Persönliche Zugänge und Forschungsthemen:
Die Teilnehmenden schilderten ihre persönlichen Zugänge zur Umweltgeschichte und ihre Forschungsinteressen. Watanabe fand über sein Engagement, historische Quellen nach Tōhoku-Erdbeben und Tsunami 2011 zu bewahren, zur Katastrophengeschichte. Fujihara beschäftigte sich mit Agrartechnologie und gelangte darüber zur Ernährungs- und Umweltgeschichte. Asmussen kam über die Wissenschafts- und Bergbaugeschichte zur Beschäftigung mit der Umwelt. Uekötter hat seine gesamte bisherige Karriere umweltgeschichtlichen Themen gewidmet und erforscht nun Monokulturen.
- Themen und Schwerpunkte der Umweltgeschichte:
In Japan gibt es eine starke Tradition von Agrar-, Forst-, und Fischereigeschichte, wobei inzwischen auch urbane umweltgeschichtliche Themen und Verschmutzungsgeschichte stärker in den Blick gekommen sind, sowie historische Klimarekonstruktionen. In Deutschland war die Umweltgeschichte in den 70er und 80er Jahren stark mit der Umweltbewegung verbunden. Seitdem hat sich aber das Feld stark diversifiziert. Ein neuer Trend ist die stärkere globale Ausrichtung des Forschungsfeldes.
- Umweltgeschichte und politischer Aktivismus:
In Japan gibt es seit den 2000ern eine starke Einbindung von Historikern in die staatliche Katastrophenprävention, für die interdisziplinäre Teams historische Erkenntnisse erarbeiten. Historiker wie Fujihara engagieren sich aber auch bei Presse- und Privatinitiativen, vor allem gegen Umweltverschmutzung. Die deutsche Umweltgeschichte ist ursprünglich der Umweltbewegung entsprungen, aber in eine Phase der Selbstreflexion und Diversifizierung getreten. Aktuelle Initiativen wie das Anthropocene Commons verbinden Wissenschaft, Aktivismus und Kunst.
- Zukunftsperspektiven der Umweltgeschichte:
Alle Teilnehmenden betonten die Notwendigkeit, Brücken zwischen der Umweltgeschichte und anderen historischen Disziplinen zu schlagen, wie politische Geschichte, Agrargeschichte, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, bzw. zeigten auf, dass eindeutige Kategorien in der Umweltgeschichte verschwimmen (werden).
- Interdisziplinäre Forschung:
Die interdisziplinäre Forschung, vor allem mit den Naturwissenschaften, ist ein Gebiet, das alle Teilnehmenden als zentral und zukunftsweisend einschätzten. Herausforderungen sahen die Teilnehmenden vor allem bei disziplinären Barrieren im Umgang mit Daten und Forschungsergebnissen, die die Kommunikation außerhalb des eigenen Faches erschweren.
Insgesamt zeigte sich in diesem Roundtable ein umfassendes Bild eines institutionell etablierten, aber sich aktuell diversifizierenden und dynamischen Forschungsfeldes in beiden Ländern. Das Feld steht vor den Herausforderungen interdisziplinärer Zusammenarbeit, vor allem mit den Naturwissenschaften. Traditionell in den Umweltaktivismus eingebunden, bietet das Feld Möglichkeiten historischer Reflexionen über die aktuellen Herausforderungen durch Klimawandel und Anthropozän.
